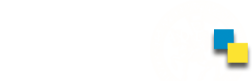Überraschender Befund der jüngsten Mobilitätsuntersuchung für die Landeshauptstadt: In Schwerin wächst vor allem der besonders umweltfreundliche Fußgängerverkehr. 34 Prozent ihrer Alltagswege legen die Landeshauptstädter inzwischen zu Fuß zurück. Das hat eine repräsentative wissenschaftliche Untersuchung der Technischen Universität Dresden im Rahmen des Forschungsprojektes „Mobilität in Städten – SrV“ ergeben.
Eine deutliche Trendwende gegenüber der Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Und sie geht nicht zu Lasten von Bus und Bahn, die 13 Prozent Anteil verbuchen, oder zu Lasten des Radverkehrs mit 15 Prozent. Die sind stabil geblieben. Rückläufig ist dagegen der motorisierte Individualverkehr in Schwerin.
Gegenüber der letzten umfassenden Untersuchung zur Alltagsmobilität im Jahr 2018 stellten die Wissenschaftler fest, dass die Schwerinerinnen und Schweriner inzwischen 63 Prozent ihrer Wege im so genannten „Umweltverbund“, das heißt mit Bussen und Bahnen, dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen.
„Das ist der beste Wert der letzten 25 Jahre. Wir haben damit eigentlich erst 2028 gerechnet“, sagt Verkehrsdezernent Bernd Nottebaum. „Im Alltag nutzen die Schwerinerinnen und Schweriner inzwischen immer seltener das eigene Auto: Der motorisierte Individualverkehr ist auf 37,4 Prozent gesunken. 2008 hatte er noch einen Höchstwert von 44 Prozent erreicht“, zitiert Nottebaum die Ergebnisse.
In der Mobilitätsuntersuchung der TU Dresden wurden Schwerinerinnen und Schweriner im vergangenen Jahr um Auskunft gebeten, mit welchen Verkehrsmitteln sie in der Landeshauptstadt ihre alltäglichen Wege absolvieren und welche Entfernungen dabei zurückgelegt werden. Da die Voraussetzungen für die Mobilität individuell sehr unterschiedlich sein können, wurde beispielsweise auch nach dem Alter, dem Führerscheinbesitz und der Erreichbarkeit von Haltestellen gefragt. Auch Personen, die nur selten unterwegs sind, waren ausdrücklich zur Mitwirkung aufgerufen, da das Verkehrsverhalten der gesamten Wohnbevölkerung erfasst werden sollte. Die Studie hatte sich an alle Schichten der Bevölkerung gewandt. Dazu wurde eine repräsentative Stichprobe aus dem Einwohnermelderegister zufällig gezogen. Die anonymisierte Auswertung liefert neben stadtspezifischen Erkenntnissen auch stadtübergreifende Trends, die von der Verkehrsplanung zu berücksichtigen sind. Hierzu gehören beispielsweise auch die Mobilität von bestimmten Personengruppen wie beispielsweise Senioren oder Kindern und die Nutzung von Sharing-Angeboten.
Die Ergebnisse bestärken die Schweriner Verkehrsplaner, dem Fußgängerverkehr noch mehr Augenmerk zu schenken. „So möchte die Stadt die Planung der Fußwege im kommenden Jahr mit einem neuen Fußverkehrskonzept auf eine neue Basis stellen. Schwerin gilt als Stadt der kurzen Wege und hat von seiner Größe und Siedlungsstruktur besonders gute Voraussetzungen, um zu Fuß mobil zu sein“, sagt der Verkehrsdezernent. Weitere interessante Ergebnisse des Forschungsprojektes „Mobilität in Städten – SrV“, sollen in den nächsten Wochen veröffentlicht werden.
Hintergrund
Die Befragung ist Teil des Forschungsprojektes „Mobilität in Städten – SrV“, das in mehr als 500 deutschen Städten und Gemeinden zeitgleich durchgeführt wurde. Das Projekt stellt seit 1972 regelmäßig wichtige Erkenntnisse und Grunddaten für die örtliche und regionale Verkehrsplanung bereit. In der bereits 12. Fortschreibung der SrV-Zeitreihe wurden insgesamt mehr als 270.000 Personen befragt.
Das als „System repräsentativer Verkehrsbefragungen“ (SrV) konzipierte Projekt wurde an der TU Dresden bereits 1972 begründet. Die Landeshauptstadt Schwerin hat seitdem kontinuierlich teilgenommen. Durch die regelmäßige Wiederholung dieser Untersuchung im Abstand von fünf Jahren liegen Erkenntnisse zur Verkehrsentwicklung über einen Zeithorizont von nunmehr 50 Jahren vor. Sie zeigen unter anderem, dass Mobilität und Verkehr stadt- und gemeindespezifisch große Unterschiede aufweisen können. Umso wichtiger ist es, die örtliche Verkehrsplanung durch regelmäßige Aktualisierung der Datengrundlagen zu unterstützen.