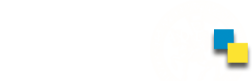© LHS/ Katalin Baruth
An dem Beispiel der Haubenschachteln lässt sich sehr gut beobachten, wie stark sich der heutige Umgang mit Sammlungsobjekten im Vergleich zu früher geändert hat. Es ist offensichtlich, dass man heute über viel mehr Wissen bezüglich der Eignung von Lagerungs- und Verpackungsmaterialien verfügt. Seit den 1980er Jahren wurden hierfür facheigene Studiengänge wie die Restaurierung und Museologie etabliert, bei denen der optimale Erhalt von Kulturgütern im Fokus steht. So versucht man heute, Konstruktionen aus Holz möglichst zu vermeiden, da diese wie bereits beschrieben schädigende, saure Gase in die Umgebung freisetzen. Diese Gase können besonders auf Metallen, aber auch auf Keramik und porösem Stein negative Auswirkungen zeigen, da sie in einen chemischen Austausch mit den Objekten gehen und dort korrosive Prozesse auslösen. Diese Prozesse können starke Schäden hervorrufen, welche mit einem nicht reversiblen Substanzverlust einhergehen.
Auch die Herangehensweise an die Restaurierung hat sich grundlegend geändert. Während des Verpackens einiger fragmentarisch vorliegender Schachtelteile fielen zum Beispiel kleine beigelegte Zettel mit der Aufschrift „Zur Restauration freigegeben“ auf. Diese Herangehensweise deutet darauf hin, dass beschädigte Objekte durch Bauteile anderer Objekte ergänzt wurden. Man spricht heute bei solch einem Vorgehen von einem „Ausschlachten“, das zur Schaffung sogenannter „Frankensteinobjekte“ führt. So hat man in der Vergangenheit Objekte geschaffen, die in dieser Art nie existiert haben. Diese Vorgehensweise ist heute unvorstellbar und findet allenfalls noch im Antikhandel statt. Werden Objekte heute restauriert, so versucht man mit geeigneten Maßnahmen, möglichst viel Originalsubstanz zu erhalten. Zeigt ein Objekt Fehlstellen auf, so werden diese möglichst originalgetreu (z. B. auf Basis alter Fotos, Zeichnungen oder durch die Orientierung, die einem das Objekt selber vorgibt) zu rekonstruieren und anzupassen.
Während des Verpackens der Objekte fielen sodann des Öfteren Maßnahmen auf, die in Ermangelung von Kenntnissen getroffen wurden und aus heutiger Sicht eher als grobe Reparaturen bezeichnet werden können. So wurde z. B. ein in zwei Teile gebrochener Spandeckel rückseitig mit zwei kleinen, aufgenagelten Holzleisten zusammengefügt. Abgesehen von der Gefahr, dass die Nägel beim Einschlagen durch den Span hindurch die farbige Fassung verletzen könnten, stellt hier das Fügen durch ein geeignetes Klebemittel eine konservatorisch milde Maßnahme dar. An einem weiteren Deckel wurden herausgelöste Holznägel durch metallische ersetzt. Auch dies würde man heute vermeiden und geeignete Holznägel oder Stifte verwenden. Trotz der Härte dieser Maßnahmen sind zumindest die zueinandergehörigen Teile erhalten geblieben. Die Beispiele zeigen aber auch, wie wichtig und nutzvoll eine optimale Lagerung und eine konservatorisch modern ausgerichtete Bearbeitung musealer Objekte sind. Denn eine der Hauptaufgaben eines Museums besteht im Bewahren von Objekten zum Zweck der Überlieferung. Sie sollten so originalgetreu wie möglich erhalten werden, damit Herstellungsweisen, Arbeitsschritte und Materialien zu einem späteren Zeitpunkt nachvollzogen werden können und um im Rahmen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung studiert werden zu können.