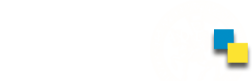Kurzbeschreibung des Leitprojekts
Präventiver Kinderschutz ist im Verständnis der Jugendhilfe in der Landeshauptstadt Schwerin ein offensiver Auftrag. Es gilt also an erster Stelle, Gefährdungslagen für Kinder zu vermeiden (primäre Prävention) sowie Hilfe- und Unterstützungsbedarfe früh zu erkennen (sekundäre Prävention). Kinderschutz erfolgt also im Spannungsfeld zwischen präventiven Angeboten, nachrangigen Hilfen zur Erziehung und einer sicheren Gefahrenabwehr in akuten Krisen.
Das präventive Kinderschutzkonzept der Landeshauptstadt Schwerin verfügt über Früherkennungssysteme für Kooperationspartner in der freien Jugendhilfe und anderen beteiligten Professionen. Es baut auf frühzeitige Beratung im Vorfeld des Leistungskataloges von Erziehungshilfen.
Frühe Hilfen sind erste Unterstützungsangebote als Ergebnis von früher Beratung, können aber auch ergänzend zu anderen Hilfen Teile von Schutzplänen sein, wenn bereits Kindeswohlgefährdungskriterien gesehen werden. Je früher Risikolagen erkannt werden, desto größer ist die Chance, diesen mit Frühen Hilfen begegnen zu können.
Frühe Hilfen haben daher den Charakter
- früher Unterstützung von werdenden Eltern,
- früher erzieherischen Förderung von Kindern im frühen Kindesalter (0-3 Jahre) und darüber hinaus,
- früher und niedrigschwelliger Unterstützungsform vor den Erziehungshilfen (Förderung von Projekten Früher Hilfen),
- früherer Wahrnehmung von Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung.
Stand der Umsetzung
Der Aufbau des Netzwerkes „Frühe Hilfen“ begann im März 2009 mit der Gründung des Koordinierungskreises. Die Leitung wird durch die Ansprechpartnerin der „Frühen Hilfen“ des Amtes für Jugend und der Mitarbeiterin der AWO Koordinierungsstelle „Frühe Hilfen“ wahrgenommen.
Die Ansprechpartnerin der „Frühe Hilfen“ des Amtes für Jugend ist neben der fachlichen Leitung und Koordinierung des multiprofessionellen Netzwerkes „Frühe Hilfen“ für die Koordinierung der Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe sowie für die Koordinierung der Umsetzung der Festlegungen des Gesetzes zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz – BKiSchG) zuständig.
Aufgabe der AWO Koordinierungsstelle „Frühe Hilfen“ ist es, in Kooperation mit den anderen Partnern des Versorgungssystems (Jugend- und Gesundheitsamt, Hebammen, Gynäkologen, freie Träger, etc.) werdende Eltern bzw. Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern sowie
Fachkräfte zu beraten, zu begleiten, zu vermitteln und zu koordinieren. Sie ist neben der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit vorrangig für die Einzelfallarbeit zuständig, welche möglichst frühzeitig und präventiv erfolgen soll. Mit Einverständnis des Hilfesuchenden stellt die
Koordinatorin den Erstkontakt zur Familie oder der Mutter/dem Vater her, klärt den Unterstützungsbedarf ab und unterbreitet entsprechende Hilfsangebote. Wenn innerhalb von 4 Wochen kein Kontakt zu der Familie hergestellt werden konnte, wird dies dem Vermittler zurückgemeldet und das weitere Vorgehen abgestimmt. Werden die Angebote der „Frühen Hilfen“ angenommen, nimmt die Koordinatorin als bereits vertraute Person an dem Erstkontakt der vermittelten Fachkräfte teil.
Ziele der Netzwerkpartner und deren bisherige Umsetzung:
- Optimierung der Zusammenarbeit und Erarbeitung von verbindlichen Verfahren
- Vereinbarung über verbindliche Verfahren für die Zusammenarbeit aller Fachkräfte sowie die Erstellung des Vernetzungshandbuches „Frühe Hilfen“
- Entwicklung einheitlicher Fragebögen für alle Fachkräfte der Jugend- und Gesundheitshilfe, Beratungsstellen, in Ämtern, frei niedergelassene Kinderärzte, Psychologen/Psychiater sowie (Familien)-Hebammen
- Niedrigschwellige Anlaufstelle für Ratsuchende (werdende) Eltern
- Koordinierungsstelle „Frühe Hilfen“ bei der AWO
Der Koordinierungskreis tagt drei bis vier Mal pro Jahr. Daran nehmen Fachkräfte aus folgenden Einrichtungen teil: Jugendamt, Gesundheitsamt, Sozialamt, Kinderzentrum (SPZ), Kinderschutzbund, Frühförderstellen, freie Träger, Wohnungsunternehmen, Kindertagesstätten, Polizei, Jobcenter, niedergelassene Kinderärzte, Ärzte und Psychologen, Hebammen, Lokales Bündnis für Familie; Seniorenbüro, AHG Poliklinik Schelfstadt sowie die Dreescher und Ramper Werkstätten. Der Koordinierungskreis ist ein offener Kreis, der jeder Zeit um Fachgruppen erweitert werden kann. Neben dem Koordinierungskreis fanden und finden Arbeitsgruppentreffen
statt, welche sich mit speziellen Fachthemen beschäftigen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden an die Teilnehmer des Koordinierungskreises weiter geleitet.
Die Steuerung und Qualität der Netzwerkarbeit ist im Vernetzungshandbuch für alle Fachkräfte aus der Jugend- und Gesundheitshilfe sowie den anderen Institutionen verbindlich geregelt.
Prognose
Die Evaluation der Wirkung der Netzwerkarbeit ist für die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung notwendig und ein stetiger Prozess. An der Schnittstelle zum Gesundheitsbereich wird derzeit gemeinsam mit den Fachkräften an einer Verbesserung der Zusammenarbeit gearbeitet. (Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit dem Gesundheitsamt erfolgte)
Im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes soll jedes neugeborene Kind im Namen der Kommune mit einem Anschreiben begrüßt werden. (Umsetzung der Konzeption „Willkommen Baby“).
Um die im BKiSCHG, Artikel 1, §2, geforderte Information aller Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen der Kindesentwicklung realisieren zu können, wurde von den Koordinatorinnen der „Frühe Hilfen“ zunächst ein „Elternbrief“ entwickelt, in dem den Eltern ein persönliches Gespräch angeboten wird.
Des Weiteren ist es unser Ziel, als niedrigschwelligen Zugang im Stadtteil Lankow ein Café einzurichten, so dass Angebote von den Eltern überhaupt wahrgenommen werden können. (Umsetzung der Konzeption „Café FuN“).
Verfahrensvorschlag
Das Leitprojekt sollte beibehalten werden